Bücherwelten: Die Geschichte von Zeb
(orig.: MaddAddam, 2013) ist der letzte Teil einer Endzeit-Trilogie, zu denen noch „Oryx und Crake“ (2003) sowie „Das Jahr der Flut“ (2009) gehören.
Sehr eindringlich und nachvollziehbar wird auch erzählt, an welchen „widrigen Umständen“ es liegt, dass die Flüchtlinge nach Europa wollen und nicht etwa in Pakistan, dem Iran oder der Türkei bleiben wollen, wo sie als Illegale zwar eventuell Schwarzarbeit bekommen, aber hemmungslos ausgebeutet werden und/oder wenig erträglichen oder gefährlichen Tätigkeiten nachgehen müssen; im vorliegenden Buch z.B. in einem Steinsägewerk im Iran.
Der Autor hat um seinen Alter Ego Hector seit 2002 eine Bestseller-Buchserie aufgebaut, die vorläufig mit seinem Roman „Hector und die Suche nach dem Paradies“ (orig.: Le jeune homme qui voulait savoir si le paradis existait, 2016) endet. Es handelt sich hierbei um ein Prequel, das zeitlich vor den anderen Büchern spielt – und das ist schon mal nicht schlecht, weil ich die 6, 7 anderen Hector-Bücher nicht kenne.
Aber ich las in 2013 seinen herausragenden Vietnam-Roman „Die kleine Souvenirverkäuferin“ (2012), der wahrscheinlich hinsichtlich seiner vietnamesischen Atmosphäre nur deshalb so gut gelingen konnte, weil der Autor seit einigen Jahren auch in Vietnam als Arzt arbeitet.
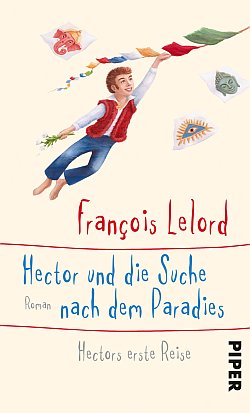
Der Roman „Hector und die Suche nach dem Paradies“ spielt in den 1970er Jahren, vorwiegend in Frankreich und Nepal. Hector macht ein Praktikum in der psychiatrischen Abteilung eines französischen Krankenhauses, verliebt sich auf den ersten Blick in die schöne Assistenzärztin. Ein alter tibetischer Arzt verwechselt seine Teesorten, infolge dessen seine Patienten ekstatische, religiöse Wahnvorstellungen bekommen. Nachdem in seine Wohnung eingebrochen wurde, taucht er unter und versteckt sich in Nepal. Hector und die Ärztin werden hinterher geschickt, um ihn auch vor der Pharmaindustrie zu warnen.
Über Bangkok (!,?) kommen sie nach Kathmandu, das fest in der Hand von Hippies ist. Sie finden FreundInnen in haschgeschwängerten Unterkünften, die zur damaligen Zeit meist Schlafsäle sind. Sie finden auch FreundInnen des tibetischen Arztes, der sich zu einem hochgelegenen Kloster aufgemacht hat. Sie philosophieren über den Sinn des Lebens, über die Existenz von Gott, über Religion, Buddha und das Nirwana, während eine sehr attraktive, Englisch sprechende Buddhistin sie hoch zum Kloster führt. Später ziehen sie weiter zu einem anderen Kloster.
In Lelords Romanen geht es immer um die Mysterien der Liebe, denen der junge Hector anscheinend ziemlich hilflos ausgeliefert ist. Insgesamt ein echt nettes Buch.
Ein anderer, meiner Meinung nach überzeugender Roman, der Hippie-Vergangenheit in Nepal aufarbeitet, ist übrigens Steffanie Burow's Roman “Im Tal des Schneeleoparden” (2010).
Der russische Autor Sergej Lukianenko ist mit seinen Romanen seit den 1990er Jahren aktiv. International bekannt wurde er jedoch erst durch die Verfilmung seines im Jahr 1998 veröffentlichten Phantastik-/Fantasy-Romans „Wächer der Nacht“ (2005). Weder den Roman noch die Filme halte ich selbst für besonders prickelnd.

Sein Roman „Spektrum“ (Spectr, orig. 2002) ist jedoch ein waschechter Sternentor- Science-Fiction, der mir auch wegen seines gedanklich- philosophischen Tiefgangs sehr gut gefallen hat und der in 2008 auch den deutschen Kurd-Laßwitz-Preis als bester ausländischer Roman erhalten hat. Ich las ihn kürzlich im Urlaub.
Der Roman spielt in mittelferner Zukunft, Jahrzehnte nachdem eine fremde Alien-Rasse Sternentore auf der Erde installiert hat und dieses intergalaktische Transportsystem immer weiter ausbaut. Durch diese Tore kann man reisen und andere angeschlossene Planeten besuchen.
Es kostet kein Geld, die Tore zu benutzen, doch am Tor sitzt ein aufrecht gehendes hamsterähnliches Alien in einem Büro, das eine neue Geschichte hören möchte. Der Besuch dort beginnt immer mit dem Satz des Aliens: „Einsam ist es hier und traurig. Sprich mit mir Wanderer“, worauf der Reisende eine Geschichte erzählt, die akzeptiert werden muss.
Dadurch werden im Roman viele Geschichten erzählt, denn der Protagonist hat den Auftrag, eine junge Frau zu finden, die den Geheimnissen des Universums auf der Spur ist und sich zu den rätselhaftesten Welten aufgemacht hat. Der Protagonist muss realisieren, dass sich die Frau infolge einer Fehlfunktion am Sternentor 6-fach kopiert hat und auf 6 Planeten unterwegs ist.
Er findet die Frau nacheinander auf diversen Planeten, doch jedesmal kommt sie innerhalb weniger Tage unter merkwürdigen Umständen ums Leben.
Es sind seltsame, ganz verschiedene Welten, die hier geschildert werden und das Buch zu einem farbenprächtigen Roman machen. Daneben hat der Roman auch viel mit der russischen Küche zu tun, denn der Protagonist ist Feinschmecker.
Die gelungene Übersetzung von Christiane Pöhlmann ist lobend zu erwähnen.
Mehr zum Buch könnt ihr z.B. bei der phantastik-couch nachlesen.
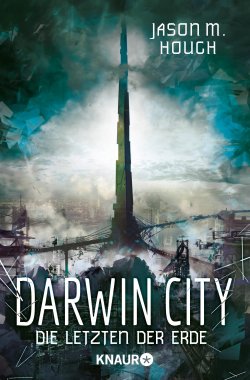
Der Roman „The Darwin Elevator“ (2013) des US-Autors Jason M. Hough schaffte es zwar auf die New-York-Times- Bestsellerliste, aber so wirklich nachvollziehen konnte ich das nicht. 200 Jahre in der Zukunft angesiedelt, erzählt der Roman von der australischen Stadt Darwin City, die unter dem Schutzschild eines Weltraum-Lifts Zufluchtsstätte der vielleicht letzten Menschen geworden ist, während eine Zombie-artige Seuche den Rest der Welt heimgesucht und die Zivilisation zerstört hat.
Einige wenige Personen sind auch immun gegen die Seuche. Mit den letzten funktionsfähigen Flugzeugen fliegen sie manchmal raus in die Welt, um in den Ruinen der Zivilisation wertvolle Gegenstände zu bergen. Das birgt Gefahren.
Den weitaus größten Teil des Buches nimmt jedoch ein Machtkampf um die Ressourcen in Darwin City selbst ein. Und dieser Machtkampf zwischen der Stadt und den besiedelten Raumstationen am Lift ist zwar hinlänglich spannend und flüssig erzählt, führt die Geschichte aber nicht unbedingt stringend weiter und lässt – zumindest in der deutschen Übersetzung – auch keine besonderen stilistischen Merkmale erkennen. Die Charaktere der Handlung sind ziemlich schablonenhaft in gut und böse aufgeteilt.
Mittlerweile gibt es zwei Fortsetzungen des Autors.
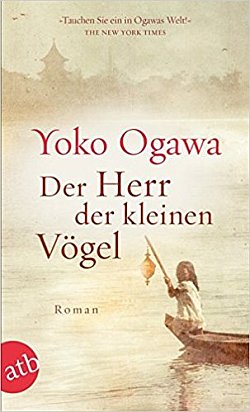
Yoko Ogawa' s Werk entdecke ich erst seit 2014. Ihr Roman „Der Herr der kleinen Vögel“ (orig.: Kotori, 2012) ist nunmehr immerhin schon der dritte Roman, den ich von ihr gelesen habe.
Frau Ogawa erzählt oft Außenseiter-Geschichten. Auch dies eine solche Geschichte. Sie erzählt von zwei scheuen Brüdern, die zurückgezogen in einer kleineren japanischen Stadt leben, kaum jemanden dort kennen (obwohl sie die Stadt quasi nie verlassen haben und Reisen nur auf dem Papier planen und bis zum gepackten Koffer durchführen) und sich praktisch nur für Vögel interessieren.
Der Roman zieht sich über Jahrzehnte hin und erzählt dabei sowohl von den festgefahrenen kleinsten täglichen Ritualen als auch von den Schicksalsschlägen. In Zentrum steht dabei über viele Jahre die Vogelvoliere eines Altenheims und späteren Kindergartens, deren Betreuung die Brüder zeitweise übernehmen.
„Der Leser wird eingeladen, zur Ruhe zu kommen und einer Geschichte zu lauschen, auf die man sich einlassen muss, die dann aber einen ganz eigenen poetischen Zauber entfaltet“, nachzulesen bei whatchareadin.
Die einfühlsam-sentimentale Übersetzung aus dem Japanischen von Sabine Mangold ist sicherlich auch zu würdigen.
Der britische Autor Nigel Barley betrieb ethnologische Feldforschung und brachte insbesondere in den 1980er Jahren einige interessante Bücher zu seinen Erlebnissen heraus. Er macht sich lustig über seinen Berufsstand, wobei er die Ethnologen als „harmlose Irre“ bezeichnet, die sich immerhin dadurch von den anderen Berufsständen unterscheiden, dass sie wenigstens bei den „Naturvölkern“ keinen schweren Schaden anrichten, denn ihre Aufgabe ist es, nur zu beobachten und zu recherchieren.
Bereits im Jahr 2000 las ich anlässlich meiner Durchquerung der indonesischen Insel Sulawesi „Hallo, Mister Puttymann“ (1989), denn das Buch spielt dort.
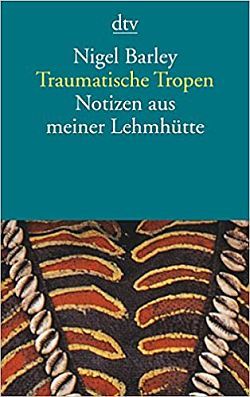
In „Traumatische Tropen – Notizen aus meiner Lehmhütte“ (Adventures in a Mud Hut: An Innocent Anthropologist Abroad, 1986) berichtet er indes aus Kamerun, wo er die Dowayos „erforscht“ hat. Das Buch wurde ein Welterfolg. Boshaft-witzig schildert er seine Probleme mit der irrwitzigen kamerunischen Bürokratie, von den Wochen, die er gebraucht hat, um überhaupt mit einem klapprigen Auto in Richtung Stammesgebiet aufbrechen zu können.
Später vor Ort sind es meist Missionare, die ihm trotz ihres zweifelhaften Berufsstandes unentbehrliche Hilfe leisten.
Er bekommt einen „Dolmetscher“ zugeteilt, versucht die Dowayo-Sprache zu lernen, baut Kontakte auf. Aber alles ist schwierig in seinem täglichen Leben, nix funktioniert problemlos, alles sehr primitiv. Die Kontakte verhelfen ihm zu einer echten Hütte in einem Dorf. Doch Bett, Stühle, Elektrizität, geniessbare Nahrungsmittel – all das gibt es nicht, werden Objekte der Sehnsucht.
Krankheiten wie Malaria und Gelbsucht werfen ihn zeitweise nieder. Und etwas herauszufinden über das Volk (Riten, Glaubensvorstellungen, Sexualität …), gestaltet sich sehr zäh, da die Regenhäuptlinge etc. ihre Geheimnisse nur zögerlich und in jeweils kleinsten Bruchstücken Preis geben.
Das Buch kann man immer noch kaufen. Es wirkt heute etwas angestaubt, jedenfalls glaube/hoffe ich, dass sich vielleicht doch etwas im Land in den letzten 30 Jahren gebessert hat , z.B. bei Kommunikation und Infrastruktur. Ein vergleichsweise gut ausgebautes Straßennetz soll es in Kamerun jedenfalls geben.
Auf der anderen Seite, wenn man die Reisehinweise des Auswärtigen Amtes liest, hört es sich – vorsichtig ausgedrückt - nicht nach einem uneingeschränkt zu empfehlenden Reiseziel an.
In 2015 war Barley hierzulande noch mal groß in der Presse, weil ein deutscher Verlag mit 6 Jahren Verspätung seine Romanbiografie „Bali. Das letzte Paradies“ herausbrachte - über Walter Spies, einen deutschen Aussteiger, der von 1895 bis 1942 lebte und ab 1923 auf Bali zu Hause war. Dieses Buch sollte ich wahrscheinlich auch noch lesen.
Barley lebt zeitweise auf Bali. Ich schätze mal, er wird sich nicht überreden lassen, seine Kamerun-Erlebnisse zu aktualisieren.
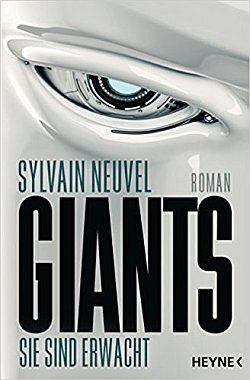
Dieser Debut-Roman „Sleeping Giants“ (2016) des kanadischen Autors bekam meist sehr gute Kritiken. Genre: Science Fiction. Nahe Zukunft. Eine riesige metallene Hand wird gefunden, ca. 7 m lang. Material: unbekannt, Alter: ca. 6.000 Jahre. Später findet man weitere Körperteile verstreut auf der ganzen Welt. Es stellt sich heraus, dass die Teile zusammengebaut und bedient werden sollten – und wahrscheinlich eine steuerbare gigantische Waffe im Form eines Roboters sind.
Und – der Roboter ist kein Geschenk, sondern ein Prüfstein für die Menschheit.
Das Treiben der Amerikaner bleibt den anderen Mächten nicht unverborgen. Der Roman bekommt dadurch einen militärisch-politischen Touch. Das gefällt mir selbst ja nicht so gut. Aber andererseits, das Besondere am Buch ist, dass es fast ausschließlich aus vielen Gesprächsprotokollen und Tagebucheinträgen besteht, die das Geschehen und die Verfassung der ProtagonistInnen lückenhaft dokumentieren. Das hat seinen Reiz.
„Zwischenmenschliche Krisen bleiben integraler Teil der Handlung“, meint phantastik-couch zu der Frage, inwieweit die Figurenzeichnung im Roman überzeugt.
Nur leider ist die Geschichte wieder ein Mehrteiler, dessen zweiter Band inzwischen auch bereits erschienen ist.
Zülfü Livaneli ist in der Türkei sowohl als Sänger, als auch als Filmregisseur und Buchautor bekannt.
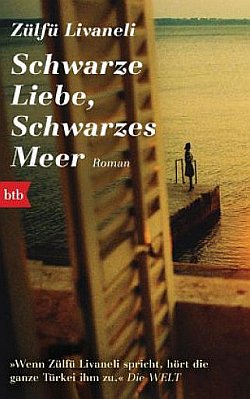
Sein Roman „Schwarze Liebe, Schwarzes Meer“ (orig.: Kardesimin Hikayesi, 2013) handelt von einem älteren, etwas kauzigen Ingenieur, der seinen Beruf an den Nagel gehängt hat und sich in ein Dorf am Schwarzen Meer unweit der bulgarischen Grenze zurückgezogen hat. Er wohnt dort in einem alten Haus voller Bücher, hat einen großen furchterregenden Hund. Eines Tages passiert nach einer Feier ein Mord an einer schönen Frau.
Eine junge Journalistin aus Istanbul kommt ins Dorf, um zu recherchieren.
Erst kommt sie im Krämerladen unter, später beim Ingenieur, der ihr interessante Mordtheorien und andere Geschichten erzählt. Später erzählt er ihr über Tage hinweg die Geschichte seines Bruders, eine tragische Liebesgeschichte, die nach Russland führt. Doch nichts ist, wie es scheint.
Ein insbesondere atmosphärisch überzeugendes Buch, flüssig zu lesen, ansprechend übersetzt von Gerhard Meier.
„Zülfü Livaneli spielt mit seinen Lesern und das macht er meisterlich“, meint lovelybooks.
Vikas Swarup's Roman „Rupien! Rupien!“ (orig.: Q & A, 2005) wurde in 2008 von Danny Boyle als „Slumdog Millionär“ erfolgreich verfilmt. Ein toller Film, ein tolles Buch. Leider ist es schon wieder 7, 8 Jahre her, seit ich den Film sah, ich habe Erinnerungslücken. Ich schätze mal, dass das Buch einen deutlichen Touch düsterer ist.
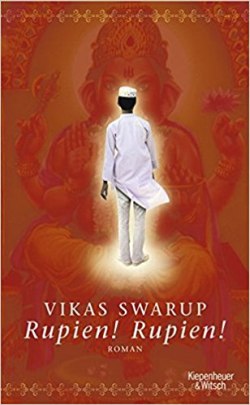
Erzählt wird hier aus der Perspektive eines indischen Jungen. Dieser nahm an einer Quizshow teil und steht diese bis zum Höchstgewinn von 20 Milliarden Rupien durch, obwohl er – aus einem Slum kommend - kaum Schulbildung hatte. Er landet daraufhin im Gefängnis. Eine Reporterin kommt und fragt, woher er all diese Antworten wusste. Das ist einer lange Geschichte. Zu jeder Frage erzählt er der Frau eine Geschichte aus seinem Leben, die die Lösung der speziellen Frage in der Quizshow bereit hält.
Und diese Geschichten sind allesamt ziemlich intensiv tragisch und finster. Man erfährt hier – aus Unterschicht-Perspektive - sehr viel aus dem Leben im indischen Alltag mit seinen vielfältigen Gefahren. Und es kommt nahezu alles vor, was man aus Indien schon mal gehört zu haben meint. Das Buch macht - bedingt - Lust auf eine Indien-Reise, wenn man sich noch traut - etwas, was man selten von einem Buch behaupten kann.
„Indien mit den Komponenten sozialer Ungleichheit und Ungesetzlichkeit, ein Land, in dem Raub, Mord, Betrug und Überfälle an der Tagesordnung sind, bietet das Bild eines vielfarbigen Völkergemischs übertüncht noch von kolonialer Vormachtherrschaft. Mit unglaublicher Fabulierkunst und doch realitätsnah hat der Autor Vikas Swarup seine Geschichte erdichtet“, sagt die leselupe.